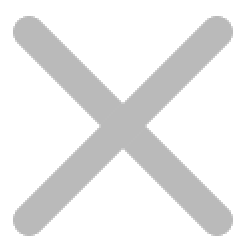Wenn Wohnen zum Luxus wird
Steigende Mieten treffen nicht alle gleich. Aline Masé, Leiterin Fachstelle Sozialpolitik bei Caritas Schweiz, erklärt, warum Armutsbetroffene besonders unter der Wohnkrise leiden und welche Massnahmen jetzt nötig sind.
Menschen mit knappem Budget spüren die Wohnkrise besonders stark – weshalb?
Sie müssen im Verhältnis zu ihrem Einkommen in der Regel viel mehr für Wohnen ausgeben. Die Haushaltsbudgeterhebung des Bundes zeigt, dass Personen in den untersten 20% der Einkommensskala etwa ein Drittel für Wohnen und Energie ausgeben. Schaut man genauer hin, wird deutlich, dass Familien mit geringem Einkommen häufig deutlich mehr für die Miete ausgeben.
Generell gilt: In einkommensschwachen Haushalten geht der Lohn fast ganz für Fixkosten wie Wohnen, Energie, Krankenkasse, Kommunikation sowie Lebensmittel und Mobilität weg. Bei der Wohnungssuche kommen noch die nicht finanziellen Aspekte hinzu: Diskriminierung wegen Schulden, Betreibungen, Sozialhilfebezug oder Herkunft.
Was sind «prekäre Wohnsituationen»? Welche Folgen haben sie für die Betroffenen?
Darunter versteht man Zustände wie Überbelegung, also zu viele Personen in zu wenig Zimmern, eine schlechte Wohnqualität wie etwa mangelhafte Isolierung, Schimmel, Lärm und fehlender Aussenraum sowie die Angst vor Wohnungsverlust. Das verursacht enormen Stress, besonders bei einkommensschwachen Menschen, die ohnehin unter dem Druck stehen, ihre Existenzgrundlage zu sichern. Studien zeigen, dass solche Bedingungen psychische Probleme verursachen oder verstärken können. Besonders Kinder leiden unter zu wenig Platz und fehlenden Rückzugsmöglichkeiten.
Wie könnten Armutsbetroffene auf dem Wohnungsmarkt besser unterstützt werden?
Eine Hürde ist das Mietzinsdepot. Es gibt bereits Wege, Wohnungsuchende hier zu unterstützen, etwa mittels eines städtischen Fonds oder Garantiescheinen. Auch rechtliche Hilfe in Mietfragen ist wichtig. Beratungsangebote zum Thema Wohnungssuche oder auch das Angebot der Solidarhaftung von Domicil können den Zugang zum Wohnungsmarkt vereinfachen. Ein weiteres Problem sind Besichtigungstermine am Nachmittag, die oft mit der Arbeit kollidieren. Wohnungsanbieter:innen könnten durch alternative Termine die Zugänglichkeit verbessern.
Welche Massnahmen sind für eine spürbare Entlastung der Betroffenen dringlich?
Kurzfristig bleibt nur, die Menschen direkt zu subventionieren, wie es bei den Krankenkassen mit den Prämienverbilligungen gemacht wird. Das ist zwar lediglich Symptombekämpfung, aber dringend nötig, denn Hilfe in zehn Jahren nützt heute nichts.
Das Problem Wohnen betrifft heute schon Familien bis in den Mittelstand und wird in den nächsten zehn Jahren eine grosse sozialpolitische Herausforderung sein. Die langfristigen Veränderungen müssen politisch initiiert werden, beispielsweise mit einer aktiven Wohnbaupolitik von Kantonen und Gemeinden.
Link zum Caritas-Positionspapier «Wie die Lage auf dem Wohnungsmarkt die Armut verschärft».